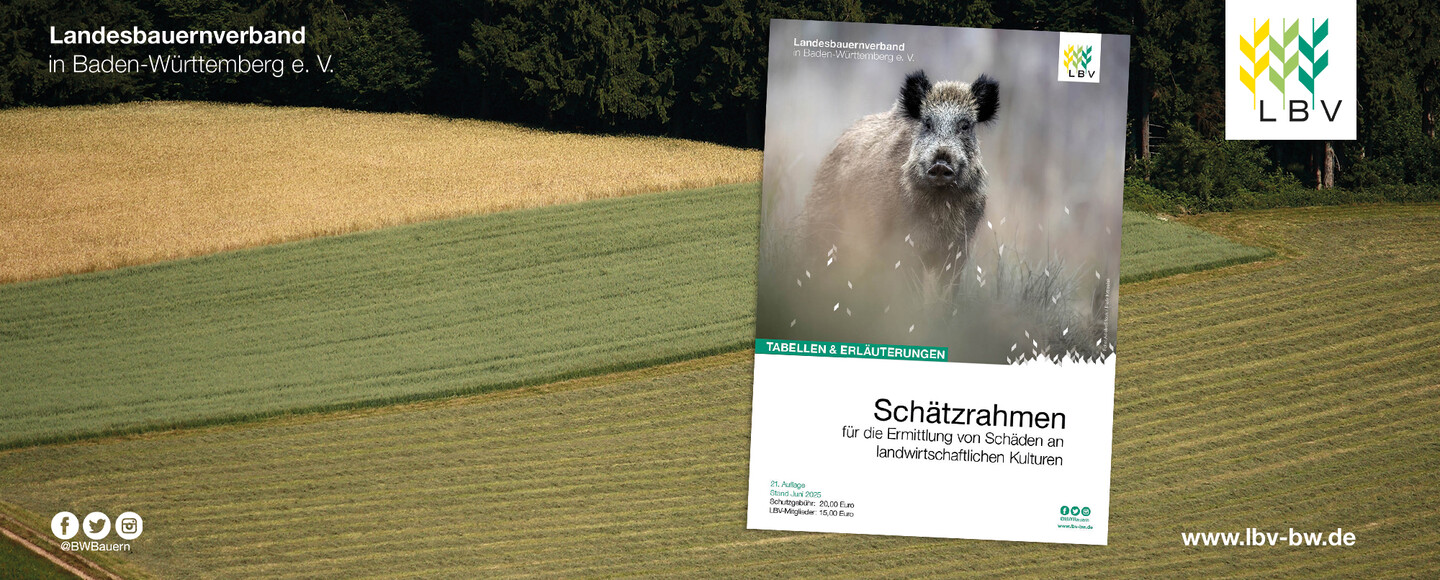Bauerntag in Hechingen
Landwirtschaft ist Vielfalt
Hechingen (Zollernalbkreis), 26. Januar 2019
Bauerntag in Hechingen
Angst schürende Polemik
„Es werden bewusst Ängste geschürt. Sie kennen diese Schlagzeilen. Zum Beispiel die Feinstaubgeschichte, die gerade kursiert und auf einem konstruierten Rechenmodell beruht, so dass es das gewünschte Ergebnis gibt. Oder der BUND mit seinen Pestizid-freien Gemeinden. Wie auch der Pestizidbericht des NABU Baden-Württemberg, der nur auf Annahmen basiert. Das alles ist billige Polemik nach dem Motto ‚Es wird schon etwas hängen bleiben‘“.
Verteilungsstreit um Agrargelder
Der Tübinger Kreisobmann Jörg Kautt weist gleich zu Beginn seiner Rede beim Bauerntag der Kreisbauernverbände Tübingen und Zollernalb am 26. Januar 2019 in Hechingen (Zollernalbkreis) auf die seit einiger Zeit wieder laufenden Kampagnen von „millionenschweren“ Nichtregierungsorganisationen (NGO) hin. Dabei gehe es um die zukünftige Agrarförderung und die Verteilung der EU-Gelder in der Zukunft. Hier wollten „diverse Vereinigungen auch etwas abhaben“, bringt es Kautt auf den Punkt. So komme auch aus Teilen der Politik die Forderung „Öffentliches Geld nur für öffentliche Leistungen.“
Schäfer einstimmig bestätigt
Der Tübinger Kreisobmann hatte zu Beginn des Bauerntages seinen Kollegen Ale-xander Schäfer vom Kreisbauernverband Zollernalb entschuldigt, der noch im Krankenhaus liegt, aber sich auf dem Weg der Besserung befinde. Schäfer wurde in Abwesenheit einstimmig für drei weitere Jahre zum Kreisobmann gewählt. Seine Bereitschaft zur Kandidatur hatte er auch im Krankenstand beibehalten, wie Wahlleiter Augustin Stifel den Teilnehmern des Bauerntages berichtet hatte.
Der Kitt Europas
„Die Landwirtschaft ist der Kitt Europas, der einzige Wirtschaftsbereich mit einer einheitlichen Regulierung“, erklärt Kautt in seiner Bauerntags-Rede. Die deutsche Landwirtschaft „ist in keiner Glaskugel, wir sind auf dem Weltmarkt, es gilt der Weltmarktpreis“, betont er. „Wir produzieren in Europa, besonders in Deutschland, Lebensmittel in bester Qualität, zu den aller höchsten Umweltstandards. Wir haben in Deutschland die höchsten Anforderungen an die Tierhaltung. Diese Auflagen sind Leistungen der Landwirtschaft für die Öffentlichkeit. Landwirtschaft bedeutet Kulturlandschaft mit vielzähligen Lebensräumen“, erläutert der Kreisobmann.
„Um mit diesen Auflagen wirtschaftlich zu überleben, erhalten wir diese Ausgleichszahlungen.“ Weitere Kürzungen hätten einen stärkeren Strukturwandel zur Folge, „was ja angeblich unsere Kritiker gerade nicht wollen.“ Jede neue Auflage erhöhe die Kosten, die erst wieder verdient werden müssten. Für den einen oder anderen sei dies „der Grund, den Betrieb zu schließen.“
Pflanzenschutz wohl überlegt
Bundesumweltministerin Svenja Schulze habe einen Glyphosat-Ausstiegsplan erarbeitet, kritisiert Kautt die Aktivitäten der Ministerin in fremden Sachgebieten. Schulze hätte doch im eigenen Ressort genug zu tun. Als Beispiel nennt er die Ausfuhren deutschen Elektroschrott nach Afrika und Rumänien als „ Müllhalde Europas auch mit deutschen Gelben Säcken“. Für den Landwirt seien Pflanzenschutzmittel ein erheblicher Kostenfaktor, dessen Einsatz sehr wohl überlegt werde.
Kautt erinnert an die Aussage von Prof. Dr. Andreas Hensel, dem Präsidenten des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR): „Die wirklichen Probleme liegen nicht bei den Pflanzenschutzmittelrückständen. Das Risiko durch Haushaltschemikalien ist exorbitant höher. Selbst Kinderspielzeug kann viel gefährlicher sein. Wir wären heilfroh, wenn Kinderspielzeuge nur annähernd so streng reguliert wäre wie Pflanzenschutzmittel.“
Aktiver Umweltschutz
„Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Landräten unser beiden Landkreise be-danken. In der Abteilung Landwirtschaft und auf den Ämtern haben wir Fachleute. Diese Beratungsleistung ist unabhängig und kompetent. Das ist aktiver Umweltschutz. Dankeschön!“
Höherer Preis, niedriger Absatz
Die Hochschule Osnabrück untersuchte das Einkaufsverhalten in 18 Edeka- und Norma-Märkten mit mehr als 18.000 Käufen, kommt Kautt auf eine aktuelle Studie zu sprechen. Bei einem Preisaufschlag von 10 bis 13 Prozent wurde von 16 Prozent der Verbraucher nach Tierwohlprodukten gegriffen. Bei geringfügigen Preissteigerungen ging der Absatz allerdings deutlich zurück. Gleichzeitig wurden im Kassenbereich Befragungen durchgeführt. Hier gaben deutlich mehr Konsumenten an, dass sie Tierwohlprodukte bevorzugen würden.
Bauchweh wegen Bioland und Lidl
Der Kreisobmann nennt ein weiteres Beispiel, wie Wunsch und Wirklichkeit beim Einkauf auseinanderklaffen. 62 Prozent der bayerischen Verbraucher wünschten sich günstigere Bioprodukte. Das habe die Andechser Molkerei Scheitz in ihrer bundesweiten Studie „Verstehen Sie Bio?“ ermittelt. Damit liegen die Bayern über dem Bundesdurchschnitt von 60 Prozent. Nur jeder dritte Bundesbürger halte das Preis-Leistungsverhältnis bei Bioprodukten für angemessen.
„Bei solchen Meldungen bekomme ich Bauchweh, wenn ich an die Zusammenarbeit von Bioland und Lidl denke, besonders, wenn jetzt Biomilch für 1,05 Euro je Liter bei Lidl angeboten wird“, meint Kautt. Würden die Bio-Preise sinken, gäbe gibt es „zwangsweise“ einen stärkeren Strukturwandel oder gar Strukturbruch im Biobereich.“ Als eine Folge werde die landwirtschaftliche Produktion ausgelagert. Sie werde dann an solchen Orten stattfinden, wo „die Menschenrechte niedriger sind als bei uns der Tierschutz“, gibt Kautt zu bedenken.
Mehr Greening als gesagt
Der Landwirtschaft werde vorgeworfen, nicht oder zu träge auf die Anforderungen der Zeit zu reagieren, Greening würde nichts bringen. Tatsächlich jedoch, so Kautt, hatte die Landwirtschaft in Deutschland 2018
- 260.000 ha Landschaftselemente, Brachen und Feldrandstreifen,
- 930.000 ha Zwischenfrüchte und Untersaaten,
- 175.000 ha Leguminosen-Anbau und
- 1,365 Millionen ha Greening bei 16,6 Millionen ha Anbaufläche.
Zudem realisiert
- der Landesbauernverband (LBV) die Aktion „Baden-Württemberg blüht auf“ mit reger Beteiligung;
- der Deutsche Bauernverband (DBV) mit der Umweltstiftung Michael Otto seit zwei Jahren das F.R.A.N.Z.-Projekt mit intensiver Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und naturschutzfachlicher Forschung.
Landwirtschaft ist Vielfalt
„Landwirtschaft bei uns ist Vielfalt. Jeder Betrieb, der zumacht, ist ein Verlust“, zieht Kautt das Fazit seiner Rede.
Hauck spannt weiten Bogen
Hauck spannt in der Hechingen Stadthalle einen weiten Bogen von der Agrarstruktur bis zur Agrarpolitik, von der Regionalität bis zur Internationalität. Von rund 20 Hektar in Europa schwankt die durchschnittliche Betriebsgröße zwischen über 130 Hektar in Tschechien, rund 3,5 Hektar in Rumänien bis zu 1,2 Hektar auf Malta. Diese große Spannweite der agrarstrukturellen Verhältnisse in der EU mache deutlich, so der Abteilungsleiter Landwirtschaft im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR): „Wir werden über die Agrarförderung nicht die Probleme beispielsweise in Rumänien lösen können“. Dennoch, so Hauck, wisse jeder, der schon einmal in früheren Zeiten im Zoll beispielsweise in Kehl am Rhein tätig gewesen wäre, „was Schengen wert ist“, wie wichtig die Einheit und Einigkeit Europas sei.
Große Unterschiede in Europa
Interessant ebenso der EU-Strukturvergleich bezüglich des Alters der Betriebsleiter. Danach beläuft sich deren Anteil unter 40 Jahren in Deutschland auf 14,6 Prozent und über 65 Jahren auf 8,2 Prozent. Im EU-Durchschnitt sind es 10,9 und 31,9 Prozent, in Rumänien dagegen 7,6 und 44,3 Prozent. Polen wiederum liegt mit 20,3 bei den unter 40-Jährigen und mit 11,7 Prozent bei den über 65-Jährigen mit an der Spitze Europas.
Dies zeige, wie massiv in unserem nordöstlichen Nachbarland in den vergangenen Jahren in die Landwirtschaft investiert worden sei, beispielsweise im Obstbau. Polen ist heute der größte Apfelerzeuger Europas und überhaupt ein großer Agrarproduzent mit hohen Ausfuhren nach Deutschland.
Strukturwandel hält an
In den vergangenen 20 Jahren belief sich der durchschnittliche Strukturwandel in Deutschland zwischen -3,3 und -1,6 Prozent pro Jahr. Das sieht so aus, als würde er etwas abflachen. „Hier darf man sich nicht täuschen lassen“, mahnt Hauck, tiefer zu analysieren.
In den vergangenen Jahren sei in der Ferkelerzeugung und Milchviehhaltung ein „rasanter Strukturwandel“ abgelaufen. So hätten beispielsweise in der Muttersauerhaltung 50 Prozent der Betriebe aufgegeben. Die Wertschöpfung aus diesem Bereich sei ins Ausland abgewandert. Eine Ursache hierfür sieht der Ministerialdirigent in der niedrigeren Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Wettbewerbern in anderen EU-Staaten.
Steigende Volatibilität
In den Unternehmensergebnissen sieht Hauck sich die steigende Volatilität an den Märkten und im Einkommen widerspiegeln. Das wurde in den vergangenen Jahren insbesondere in der Veredlung deutlich, aber ebenso in anderen Betriebszweigen.
Dabei sieht die Prognose für die Ergebnisse im laufenden Wirtschaftsjahr 2018/19 ungünstiger als im Vorjahr aus. Nach Analyse der Landwirtschaftskammern stehen bundesweit die Zeichen der Veredlung auf Einbußen. Im Durchschnitt der anderen Sparten sei bestenfalls mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen.
Zielkonflikte auch bei Bio
In der multifunktionalen Landwirtschaft ist es regelmäßig die Herausforderung, Zielkonflikte abzubauen. Dies betrifft auch den ökologischen Landbau, wie Hauck erläutert.
Er erinnert an die Zielmarke der früheren Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von 20 Prozent Anteil des Öko-Landbaus. Zeitgleich habe der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeslandwirtschaftsministerium Vorzüge des Öko-Landbaus festgestellt, jedoch zugleich auf die Nachteile beim Klimaschutz hingewiesen. Solche Zusammenhänge gingen in der öffentlichen Debatte jedoch oft unter, meint der Ministerialdirigent. Wolle die Gesellschaft möglichst viel Biodiversität und zugleich Klimaschutz, würde zukünftig die Landwirtschaft ein Mix verschiedener Betriebsrichtungen sein.
Besseres Risikomanagement nötig
Die große Dürre im vergangenen Jahr mache die Notwendigkeit besseren Risikomanagements deutlich, betont Hauck. Bis Ende 2018 seien rund 300 Anträge auf Dürrehilfe mit einer Schadenssumme von rund neun Millionen Euro gestellt worden, berichtet er. Zur Verbesserung des Risikomanagements bietet sich laut Hauck unter anderem an:
- die Förderung präventiver Maßnahmen wie Hagelschutznetze,
- die Prämienunterstützung bei Versicherungen sowie
- steuerliche Maßnahmen wie Absenkung der Versicherungssteuer und Krisenrücklagen.
Stärkere Wettbewerbsfähigkeit und Marktposition
„Die Zusammenhänge und Folgen stärker durchdenken" fordert Hauck in der EU-Agrarpolitik. Er verdeutlicht diesen zahlreichen Beispielen. Er nennt
- den Insektenschwund, dessen Ursachen keinesfalls allein der Landwirtschaft angehängt werden könnten,
- die Feldhasenpopulation, bei der auch natürliche Feinde wie Beutegreifer zu berücksichtigen seien, und
- die Rückkehr des Rebhuhns, die ohne Regulierung des Fuchses und greifendes Wildtiermanagement nicht stattfinden würde.
Redet miteinander
Bei all den generellen und spezifischen Zielen und Zielkonflikten der Agrarpolitik bleibe klar: Wenn die landwirtschaftliche Betriebe nicht wettbewerbsfähig seien und ihre Position in der Vermarktungskette nicht verbessern könnten, dann würden auch Umweltziele wie Nachhaltigkeit oder Ressourcenschutz nicht oder weniger erreicht.
So fordert Hauck auf, das zu tun, was der Gesellschaft momentan fehle: Zuhören und vom anderen lernen. Sein Appell: „Redet miteinander!“
Autor: hk